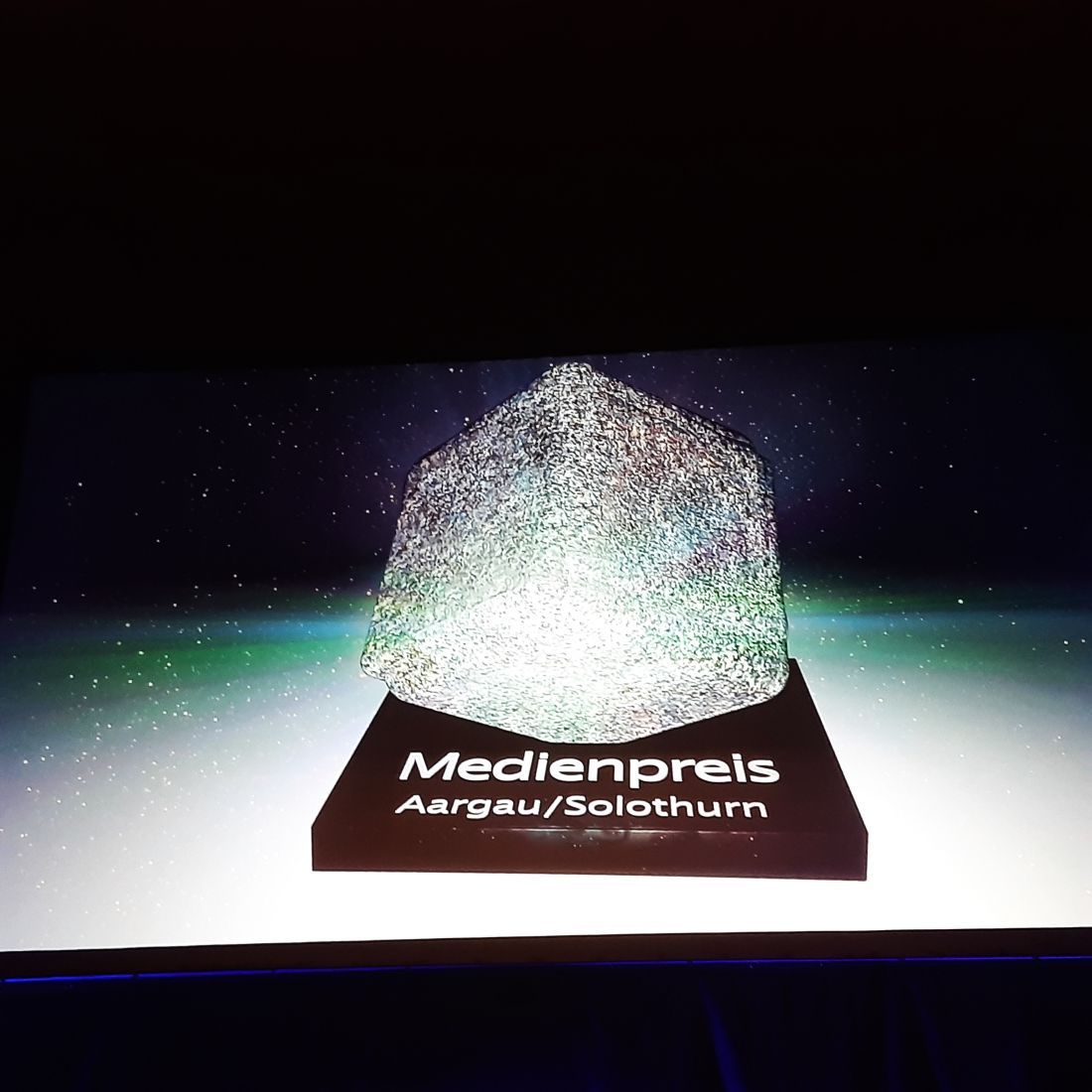In Teil 1 und 2 werden die Abschnitte von der Frybachstrasse in Schönenwerd über das Grod bis nach Däniken beschrieben. Der letzte Teil führt durch das Aarefeld – der Industriezone Gretzenbachs mit einem absolut unlogischen Grenzverlauf.

Das Aarefeld – das Gebiet zwischen der Bahnlinie und der Aare – macht etwa 15% der Gemeindefläche aus. Einen Chronisten dafür zu finden war nicht einfach. Es ist so etwas wie Terra incognita.
Ich wandere oft der Aare entlang und suche Schwemmholz. Die Güterstrasse eignet sich gut zum Rollschuhlaufen und das KKG dominiert die Landschaft, trotzdem berührt mich das Areal nicht. Auffällig aber ist, dass es immer wieder Hündeler hier hat. Und tatsächlich wird die Begehung ein Spaziergang mit Hunden.
Ich treffe mich für die Wanderung bei der Aarios AG mit Arnold Ramel, dem Seniorchef der Velofabrik. Und Überraschung: Vier Mitglieder der Jagdgesellschaft Däniken – Gretzenbach kommen mit auf die Runde. Man trifft sich jeden Sonntagmorgen um 9 Uhr zu einem Spaziergang mit den Hunden.
Schnell wird klar: Es wird kein Lauf der Grenze entlang, sondern eine Wanderung mit Blick auf die verschiedenen Elemente, die sich darin befinden.
Unsere Route führt über die Güterstrasse und die Kraftwerkstrasse bis an die Aare. Ein Stück folgen wir dem Fluss Richtung Obergösgen. Dann geht es über Landwirtschaftsland zur Industriestrasse. Die Fortsetzung bilden die Aarefeldstrasse, die Hegnauerstrasse und die Schachenstrasse. Die Güterstrasse bringt uns zur Velofabrik zurück.
Der Bahnhof von Gretzenbach

Der 2. Teil der Grenzwanderung hat mit dem Versprechen aufgehört, das Geheimnis um den Gretzenbacher Bahnhof zu lösen:
Es gibt diesen Bahnhof tatsächlich und zwar schon lange. Man muss an der Firma Kammermann vorbei in die Steinlen. Das Gebäude sieht aus wie ein Bahnwärterhäuschen. Dieses hätte der Gretzenbacher Bahnhof werden sollen. Der Bauer, dem das Land gehörte, wollte aber ums Verrode sein Land nicht hergeben und so ist das Projekt gescheitert – gebaut worden sind die Bahnhöfe Däniken und Schönenwerd.
Die Unterführung unter den Gleisen war hier so angelegt worden, dass Güterzüge hätten durchfahren können, auf der andern Seite des Bahndammes hatten die SBB einen grossen Güterbahnhof geplant.
Arnold Ramel: Das Land ist von den SBB aufgekauft worden, weil ab unserer Fabrik ein grosser Güterbahnhof errichtet werden sollte. Nach der Fläche, die sie erworben hatten, hätte das wohl der grösste Güterbahnhof der Schweiz geben sollen!
Aus diesem Projekt ist – wohl zum Glück – nichts geworden.
Mit dem Ausbau auf vier Gleise im Zusammenhang mit dem Eppenbergtunnel ist dieser Zugang zum Aarefeld zugemacht worden, der Weg endet nun beim Bahnwärterhäuschen.
Die Unterführung hier und die Unterführung zum Tennisplatz, da stand ein zweites Bahnwärterhäuschen, waren die einzigen Zugänge zum Aarefeld. In meiner Kindheit hat es auf der Strecke immer wieder Dampflokomotiven gehabt, die durchgefahren sind, obwohl die Strecke schon elektrifiziert gewesen ist. Wenn aber der rote Pfeil durchgefahren ist, so ist das immer ein Erlebnis gewesen. Dabei ist der langsamer gefahren als ein Güterzug heute.
Die Entwicklung des Aarefeld.

Aus der Vogelperspektive zeigt sich: Das Aarefeld liegt in einer alten Flussschlaufe. Pfarrer Jäggi schreibt in seinem Buch, dass im Niederamt im Laufe der Jahrhunderte 12 verschiedene Flussläufe der Aare nachweisbar seien. Und das bedeutete: Regelmässige Überschwemmungen, die das Land kaum bewohnbar und nur eingeschränkt nutzbar gemacht haben.
Der Kanalbau vor rund 100 Jahren war ein ziemlicher Eingriff in die Landschaft, da Erdaushub ist hier abgelagert worden; der Name Kipp zeugt davon. Und die Brücke bei der Cartaseta ermöglichte den Verkehr auf die andere Aareseite. Ab den 50er-Jahren begann der Ausbau des Industriegebietes und 1979 kam das Kernkraftwerk.
Auf www.geo.admin.ch zeigt historisches Kartenmaterial die Entwicklung ab 1864 auf. Der Kartenauschnitt oben zeigt die Situation im Jahre 1880.
Der Schachen
In Pfarrer Jäggis Dorfbuch liest sich auf der S. 160 zu diesem Gebiet:Dem Dorfe Gretzenbach, gegen Abend vorgelagert, dehnt sich ein mächtiger Teppich hin – der Schachen. Einst ein Meer von Stauden, bis zur Anbauschlacht im letzten Weltkrieg noch ordentlich erhalten, sind heute nur noch Fetzen erhalten. War das ein Naturmärchen – wenn der Frühling ein helles Kleid über den Kleinwald zog, dazwischen der in Gold und Silber aufblitzende Flusslauf der Aare – und der Schachenwald voller jubelnder Singvögel.

Die Foto aus dem Jahre 1946 zeigt die kleinflächige Landwirtschaft, ermöglicht durch die Entwässerung im Rahmen der Anbauschlacht während des 2. Weltkrieges. Vorher riss die Aare mal Gemeindegebiet weg, mal schwemmte sie Land an. Es war Sitte unter den Dörfern, das weggerissene Kulturland auf der andern Flussseite wieder einzufordern. Solches Wechselland hiess Schachen. So ist wohl zu erklären, dass sich im Bereich der alten Gretzenbacher-Badi ein Stück Niedergösgen auf dieser Aare-Seite befindet.
Während meiner Lehre ist das Aarefeld mein Arbeitsweg gewesen. Ich habe meine Stifti in Niedergösgen gemacht. Bei der Schneeschmelze ist hier immer überschwemmt gewesen.
Der Grenzverlauf

Eigentlich ist das Aarefeld flaches, offenes Gebiet, das einen logischen und sinnvollen Grenzverlauf ermöglichen würde. Die Realität und der Blick auf Google Maps zeigen das pure Gegenteil: Zickzack nach Belieben, einem Papageienschnabel ähnlich. Unser Grenz-Lauf wäre öfters ein Querfeldein gewesen.
Vielleicht – so die Erklärung eines weiteren Begleiters – liegt der Verlauf daran, dassdie Däniker Bauern immer ärmer als die Gretzenbacher gewesen seien und darum die Bereiche im Schatten erhalten hätten, die sonnigen Abschnitte seien den Gretzenbachern vorbehalten gewesen.
Die Aarios, der Schiess- und der Sportplatz

Die Fabrik ist erbaut worden auf Land, welches drei Grundbesitzern gehörte: Der Bally, den SBB und der Bürgergemeinde.
Nach dem Landkauf musste ich zuerst einmal mähen und mit den Buben habe ich gheuet.
Hier war bis 1970 der Sportplatz des FC Gretzenbach.
Der Platz ist aber zu klein gewesen und hat nicht der Norm entsprochen. Meisterschaftsspiele haben wohl trotzdem hier stattgefunden. Ich habe auch Fussball gespielt, in Schönenwerd in der 2. Liga. Damals hat Gretzenbach, glaube ich, noch gar keinen Fussballclub gehabt. Ich war auf dem Flügel im Sturm.
1981 ist die Velo-Produktion gestartet worden, in den folgenden 10 Jahren installierten sich die übrigen Betriebe, in einem Gebiet, von dem man wusste, dass es überschwemmungsgefährdet ist.
In den 1960 – 70 Jahren ist die zweite Juragewässerkorrektion gekommen und ich habe geglaubt, jetzt sei das Problem der Überschwemmungen gelöst. Aber wenn es zu wenig Schlaue an der Schleuse bei Port hat, dann bringen die alles fertig. 2007 hatten wir 1 m Wasser im Gebäude. Unser Schaden betrug rund 1,5 Mio Franken. Wir haben dann verlangt, dass Dämme gebaut werden. Das ist auch geschehen. Aber wenn es wirklich wieder überschwemmt, nützen die Dämme nichts, weil das Grundwasser unter dem Damm durchfliesst und nach oben drängt.
Direkt neben der Aarios-Parzelle sind eine Hecke und Wald am Entstehen – ein Aufforstungsprojekt der SBB für den abgeholzten Wald im Zusammenhang mit dem Tunnelbau.
Ich habe zufällig von diesem Projekt erfahren. Wenn das wirklich so ist, dann werden sie entschädigungspflichtig. Denn wegen des Waldabstandes, der dann gelten würde, könnte ich die Fabrik nicht mehr weiter ausbauen.
Vor etwa 50 Jahren befand an dieser Stelle die 50 m Kleinkaliber-Schliessanlage, die inzwischen in den Zingg verlegt worden ist. Der Platz des Scheibenstandes ist heute als belasteter Standort registriert.
Die Gretzenbacher Badi
Von der Velofabrik führt der direkte Weg an die Aare zur ehemaligen Badi. Der Platz ist heute überwuchert und als Badeplatz nicht mehr erkennbar. Aber ein ungewohntes Überbleibsel müsste noch vorhanden sein; im Winter, wenn die Büsche ohne Blätter sind, wird es vielleicht zu sehen sein.
Hier ist die Gretzenbacher Badi gewesen, der Plättli-Stei. Das war so bis zur Eröffnung der Schönenwerder Badi. Irgendwo im Gebüsch hat es noch ein Geländer, etwa 4 m lang, mit Haken, um die Kleider aufzuhängen. Am Sonntagnachmittag ist jeweils der alte Lehner ins Wasser gelegen und hat einen riesigen Stumpen im Mund gehabt. Der ist dick genug gewesen, dass er oben aufgeschwommen ist. Der Lehner ist ein Original gewesen. Er war vermutlich ein Angestellter bei Bally und ist immer im weissem Hemd mit Stehkragen herumgelaufen.
Die Bally-Gärtnerei
Wir folgen der Aare Richtung Ballypark bis zur ehemaligen Bally-Gärtnerei – kurz vor dem Brüggli.
Die Gärtnerei hat man in den 60er-Jahren aufgegeben. Sie haben da Blumen für den Park und zum Verkauf angepflanzt. Jetzt ist die Fläche samt dem Gretzenbacherbach im Rahmen des Schienen-Ausbaus renaturiert worden.


Die Natur hat sich breit gemacht. Bei Hochwasser bildet sich gar ein See und der Biber ist auch heimisch geworden.
Die Müllhalde
Wenn man weiter über die kleine Brücke und rechts durch die Bahnunterführung geht, trifft man auf eine Abfall-Geschichte der Vergangenheit:
Im Bereich des Tunneleinganges ist früher eine Schutti gewesen. Da hat man in den 50er-Jahren von der Hauptstrasse her den Abfall hinuntergeworfen. Man hat beim Tunnelbau gewusst, dass das ein belasteter Standort ist.
Früher hat man ja nichts gehabt. So sind wir in die Schutti schauen gegangen, ob man etwas Brauchbares findet. Das sieht man ja in ärmeren Ländern auch heute noch, wie viele Menschen davon leben. Eigentlich hätten wir nicht in die Schutti gehen dürfen.
Die Gärtnerei und die Hühnerfarm

Jetzt sind es Wohnhäuser, aber früher waren hier die Gärtnerei Schwab und eine Hühnerfarm.
Die Jagd im Aarefeld
Umgeben von Jägern wird auch von der Jagd gesprochen.
Auf der Gösgerseite ist ein Schongebiet und da wird nicht gejagt. Die Rehe kommen natürlich über die Aare, das Jagen ist wegen der vielen Spaziergänger und Hündeler aber schwierig. Wir sammeln die Tiere dann doch ein, wir ziehen sie tot unter den Autos hervor.
Im Bereich Güterstrasse – Kraftwerkstrasse sind wir an 3 Rehen vorbeigekommen. Vor lauter Konzentration auf den Weg und die Informationen habe ich sie nicht gesehen, das Auge des Jägers aber schon: Man kennt sich eben.
Sorgen bereiten die Enten:
Es hat zu viele Männchen, für die Weibchen ist das schon ein Stress. Daher sollten wir die Enten bejagen können.

Das KKG
Da, wo das KKG steht, ist ein Bauernhof gewesen, die Frau hat Pferde gehabt. Man hat ihr das Land abgekauft, den Hof geräumt und das Kernkraftwerk gebaut.
Ein kleiner Teil dieser Anlage befindet sich auf Gretzenbacher Boden, der Rest steht auf Däniker Land. Däniken hat auf Ende 2019 die Verträge über die Verteilung der Kernkraftwerk-Steuern an die Anrainergemeinden auslaufen lassen, beziehungsweise gekündigt und bezieht nun den vollen Steuerertrag. Das gefällt den Dörfern, die vorher auch in den Genuss von KKG-Steuergeldern gekommen sind, nicht und sie kämpfen nun vor Gericht um diese weggefallenen Erträge.
Der Sikh-Tempel
In Däniken und Gretzenbach sind 4 Weltreligionen mit ihren Gotteshäusern vertreten: Die Katholiken, die Reformierten, die Buddhisten und die Sikhs, die seit 2002 an der Schachenstrasse einen Tempel haben. Dieser Bau steht direkt auf der Gemeindegrenze. Der grössere Teil gehört zu Gretzenbach, die Religionsgemeinschaft ist jedoch in Däniken angemeldet.

Wir laufen daran vorbei und landen wieder beim Ausgangspunkt. Hier gibt es noch es Kafi mit Selbstgebranntem.
Für Gretzenbach sind noch interessant:
- Das neue Grundwasserpumpwerk, welches wegen des Tunnelbaus erstellt werden musste und vor zwei Jahren den Betrieb aufgenommen hat.
- Die geplante Materialaufbereitungs- und Verwertungsanlage, die wegen des eigenartigen Grenzverlaufes genau auf Gretzenbacher Boden zu stehen kommt.
- Die Bedeutung für die Bürgergemeinde:
Die Bürgergemeinde verfügt hier immer noch über Land, das sie im Baurecht abgegeben hat. Die ersten derartigen Verträge sind in den 1990er-Jahren ausgestellt worden. Das bringt der Bürgergemeinde jedes Jahr Einnahmen.
Fazit
Das Aarefeld umfasst etwa einen Sechstel des Gemeindegebietes. Interessant wäre daher der Vergleich mit dem Steueranteil, der hier erbracht wird. Diese Zahlen konnten leider nicht in Erfahrung gebracht werden.
Wichtiger als die Steuern der KMU-Betriebe sind die Menschen, die hier arbeiten und im Dorf Steuern bezahlen. Als Privatperson bezahle ich mehr Steuern denn als Fabrik-Besitzer.
Was bleibt von dieser Tour? Die Erinnerung an einen schönen Sonntagmorgen, neue Fakten und die Frage: Was wäre anders für Gretzenbach, wenn die ganze Schlaufe Däniken gehören würde? Ich für mich bin diesbezüglich nicht schlüssig geworden und suche immer noch eine gute Antwort darauf!


Bildernachweis:
| map.geo.admin.ch | (1) |
| map.geo.admin.ch Zeitreise 1864 | (3 + 4) |
| google.com/maps | (5) |
| HS | (Titelbild / 2 / 7 – 13) |